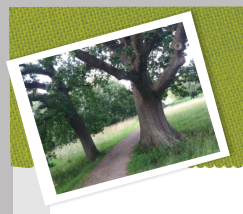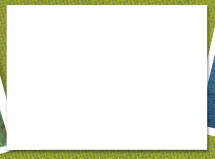Vermutlich kennt das Gefühl jeder von Ihnen: Man kommt morgens schon gar nicht richtig aus
dem Bett, nichts geht leicht von der Hand und die Stimmung ist im Keller. Meistens gibt es auch
einen akuten Auslöser dafür: ein Streit, Stress in der Arbeit, vielleicht ist jemand nahestehendem
auch etwas passiert.
Es gibt viele Auslöser für solch ein Stimmungstief, das die meisten Menschen wohl als Depression
bezeichnen würden. Die Ärzte nennen es „depressive Verstimmung“, die sie entweder nicht wirklich
ernst nehmen oder es wird gleich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. Diese Frage klingt zunächst
etwas akademisch, hat aber weitreichende Konsequenzen. Denn eine depressive Verstimmung hat
meist einen äußeren Auslöser und die angeschlagene Psyche erholt sich in der Regel nach einer
gewissen Zeit fast von selbst. Das soll nicht heißen, dass diese Verstimmung nicht auch sehr
belastend für die Betroffenen sein kann. Eine Behandlung kann also durchaus Sinn machen, speziell
wenn diese Behandlung wie am Ende gezeigt noch zahlreiche andere gesunde Auswirkungen hat.
Im Gegensatz dazu ist eine echte sogenannte endogene Depression eine meist aus „heiterem Himmel“
kommende Erkrankung des Gehirnstoffwechsels, die in viele Fällen immer wieder in Schüben auftritt.
Sie sollte unbedingt von einem Facharzt behandelt werden. Aber da viele der Abläufe im
Nervensystem bei beiden Fällen sehr ähnlich sind, können auch Menschen mit Depressionen durchaus
von den unten folgenden Tipps profitieren.
Die Hauptsymptome der beiden Zustände sind recht ähnlich: gedrückte Stimmung, Freudlosigkeit,
wenig Antrieb. Viele Betroffene äußern, dass sie nicht sie selbst sind. Auch Schlafstörungen,
Weinerlichkeit oder schlechte Konzentration sind häufig. Da eine Depression eine chronische
Krankheit ist, sind bei ihr körperliche Beschwerden als Ausdruck der Krankheit sehr viel häufiger
als bei einer Verstimmung. Symptome wie Kopfschmerzen, Nacken- oder Rückenschmerzen, Schwindel
oder Magenprobleme sind oft bei vielen Depressiven die einzigen erkennbaren Anzeichen der Krankheit.
Wie wird unsere Stimmung reguliert?
Dieser Ausflug in unsere Physiologie ist wichtig, um daraus dann die richtigen Maßnahmen für eine
dauerhaft gesunde Psyche abzuleiten. Die einfache Variante ist der Vergleich mit dem Auto: es gibt
Hormone, die dem Gaspedal entsprechen und Hormone die Bremsen. Und wie beim Auto funktioniert
auch im Körper das eine nicht ohne das andere. Es sollte immer ein gewisses Gleichgewicht herrschen.
Zu den aktivierenden Hormonen zählen beispielsweise Adrenalin und Noradrenalin, zu den entspannenden
Hormonen zählen Serotonin und Dopamin. Jeder Mangel eines dieser Hormone führt zu psychischen
Symptomen. In unserer heutigen Zeit ist ein Mangel den entspannenden Hormonen besonders häufig.
Ein Grund dafür ist, dass die Grundbaustoffe für diese Hormone mit der Ernährung zugeführt werden
müssen. Und es gibt noch reichlich weitere Gründe, warum unsere Psyche leidet:
Epigenetische Faktoren: Die Vererbung scheint eine gewisse Rolle zu spielen. Kinder eines von in
der Schwangerschaft gestressten Müttern haben oft selbst eine schlechte Stressverarbeitung.
Die gute Nachricht ist, dass diese epigenetischen Veränderungen durch Mikronährstoffe und viel
zärtliche Zuwendung in der frühen Kindheit wieder rückgängig gemacht werden können.
Neurobiologische Faktoren: Ein Mangel an bestimmten Botenstoffen im Gehirn (Serotonin, Dopamin)
wird als häufige biologisch fassbare Ursache genannt. Ebenso ist bekannt, dass depressive Symptome
auftreten, wenn dem Körper Mikronährstoffe fehlen. Ebenso wird heute eine dauernde unterschwellige
Entzündung im Körper (die sogenannte „silent inflammation“) als wichtige Ursache angenommen.
Zudem können Hormonungleichgewichte, die durch Stress verursacht sind genauso zu einer psych-
ischen Anfälligkeit beitragen wie Störungen im Schilddrüsen-Stoffwechsel. Relativ neu ist die
Erkenntnis, dass ein Ungleichgewicht im Darm (Darmdysbiose) ebenfalls zu Stimmungsschwankungen
führen kann.
Entwicklungsfaktoren: Ein überängstlicher und überfürsorglicher Erziehungsstil kann zu einer Art
erlernter Hilflosigkeit und später zu einer Anfälligkeit für Depressionen führen. Dies kann sich
sogar in epigenetischen Veränderungen an den Genen wiederspiegeln. So kann diese Anfälligkeit
sogar weitervererbt werden.
Reaktive Faktoren: Hier sind Reaktionen auf direkte Lebensereignisse gemeint. Bei Todesfällen oder
Lebenskrisen, genauso aber auch bei langdauernden Konflikten und Mobbing.
Krankheiten und Medikamente: körperliche Krankheiten und auch zahlreiche Medikamente können
eine psychische Anfälligkeit als Begleitung mit im Gepäck haben. Diese werden oft auch von Ärzten
stark unterschätzt. Zu den Krankheiten, die häufig von einer Depression begleitet werden gehören
unter anderem die Epilepsie, Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, aber auch Herzinfarkt und
Schlaganfall2, Zuckerkrankheit, Krebs und viele andere. Bei den Medikamenten mit psychischen
Nebenwirkungen sind vor allem Herzmedikamente wie Beta-Blocker und ACE-Hemmer, aber auch
Entzündungshemmer (Ibuprofen) und Antibiotika (z.B. Sulfonamide) zu nennen.
Physikalische Faktoren: Zu den wichtigsten physikalischen Faktoren zählen das Zuwenig oder
Zuviel (künstliches) an Licht. Zuwenig Tageslicht ist wohl die Hauptursache bei der sogenannten
saisonalen Depression zu Beginn des Winters. Aber auch zu viel künstliches Licht am Abend kann
eine Depression begünstigen, wenn dadurch die Bildung unseres „Schlafhormones“ Melatonin gestört
wird und so unser Tag-Nacht-Rhythmus durcheinanderkommt.
Erziehung in der Kindheit:
Dürfen wir unsere Kinder gar nicht kritisieren?
Natürlich wollen wir immer alle nur das Beste für unsere Kinder, auch wenn wir sie kritisieren.
Zum Beispiel, dass sie lernen, einen guten Eindruck zu machen, oder dass sie gute Noten bekommen,
um später im Job erfolgreich zu sein. Aber im Interesse unserer Kinder sollten wir unsere eigenen
Erwartungen öfter mal zurückstellen und den Kleinen vertrauen.
Als Menschen sind sie von Natur aus dazu veranlagt, ihr Bestes zu geben. Diese Eigenschaft sollten
wir fördern, indem wir sie loben, ermutigen und selber das vorleben, was wir uns von ihnen wünschen.
Unser oberstes Ziel in der Erziehung sollte sein, dass unser Kind sich bedingungslos geliebt und
wertvoll fühlt, unabhängig von seinen Leistungen. Denn wenn wir ihm dabei helfen, einen stabilen
Selbstwert zu entwickeln, wird es seinen Weg schon gehen – auch ohne unsere Kritik.
Quelle: https://www.eltern.de/kleinkind/erziehung
https://naturheilkompass.de/krankheiten/depression
Erklärungsversuche